Rheuma: Forschung top – Versorgung flop?
Die Rheumaforschung geht derzeit in Siebenmeilenstiefeln vorwärts - und die Patientenversorgung im Land hinkt mühsam hinterher. esanum befragt Prof. Dr. med. Hanns-Martin Lorenz zu dieser widersprüchlichen Entwicklung.
Die Rheumaforschung geht derzeit in Siebenmeilenstiefeln vorwärts - und die Patientenversorgung im Land hinkt mühsam hinterher. Fragen zu dieser widersprüchlichen Entwicklung an Prof. Dr. med. Hanns-Martin Lorenz, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie, Leiter der Sektion Rheumatologie der Universitätsklinik Heidelberg, Medizinisch-wissenschaftlicher Leiter des ACURA-Rheumazentrums Baden-Baden.
esanum: 20 Millionen Deutsche haben "Rheuma" in einer der verschiedenen Formen, wird die Erkrankung eigentlich ernst genug genommen?
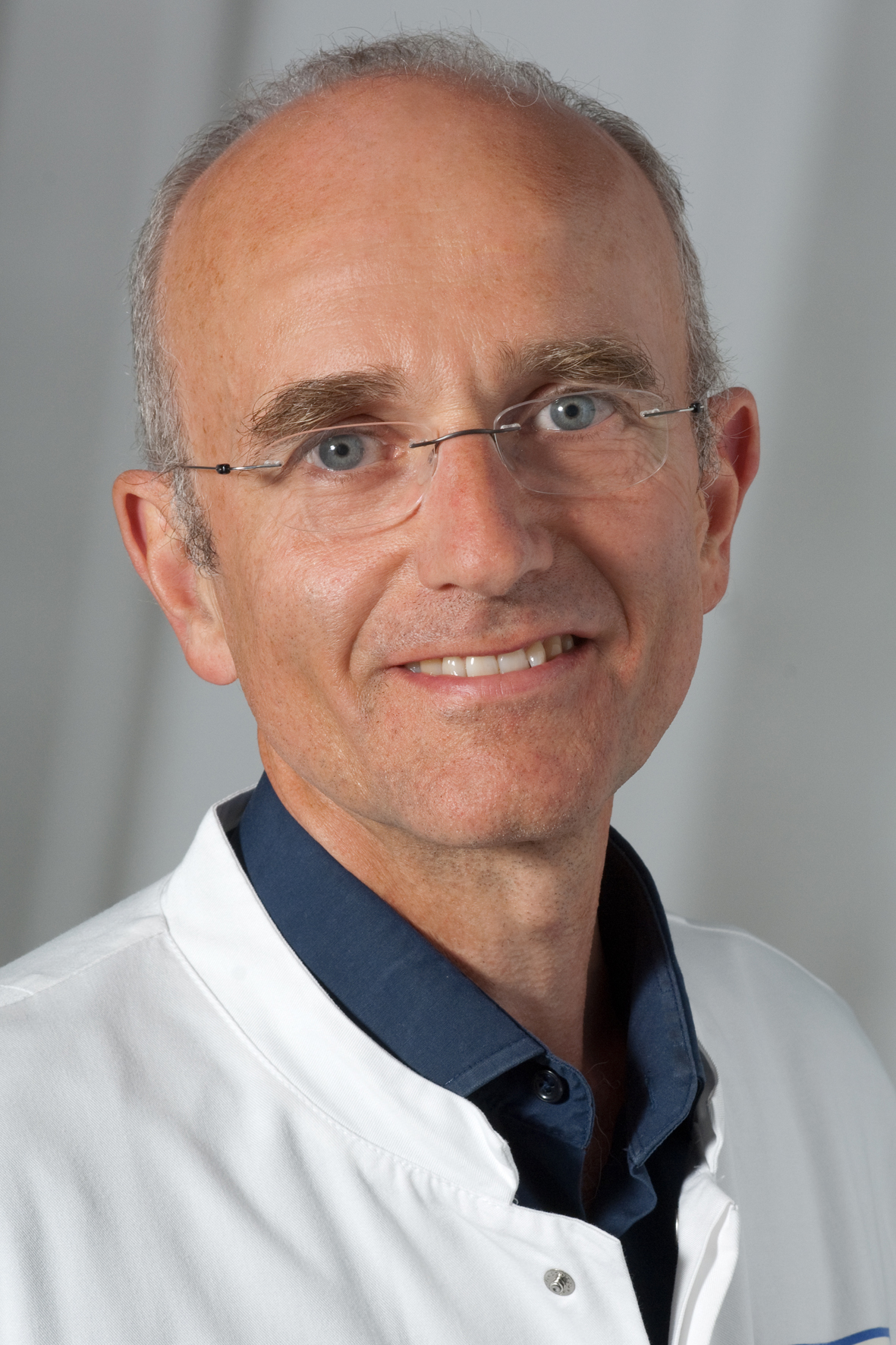
Lorenz: Wenn man die Arthrosen dazu zählt, stimmt die Zahl, bei entzündlich rheumatischen Erkrankungen sind es drei bis vier Millionen Patienten. Wahrgenommen wird das nicht so, wie wir uns das wünschen. Sonst hätten wir bessere Ausbildungsbedingungen und damit auch mehr internistische Rheumatologen. Rheuma wird in der Gesellschaft verdrängt, es wird als Krankheit der alten Frau empfunden. Kinderkrankheiten werden wahrgenommen, wenn einen die großen traurigen Augen anschauen, vor einem Tumor oder Herzinfarkt hat jeder Angst. Dagegen steht die Erkenntnis, dass man an entzündlichem Rheuma auch sterben kann, wenn es unbehandelt bleibt. Denken wir nur an die systemische Sklerose, die die Lunge zerstört oder an Gefäßentzündungen, die die Nieren zerstören. Jede chronische Entzündung ist ein Risikofaktor für Herzinfarkte oder Schlaganfälle.
esanum: Wie kommt es, dass Rheuma nicht richtig wahrgenommen wird?
Lorenz: Das ist vielschichtig: Die Patienten sind durch ihre Krankheit nicht so mobil, die entzündlich rheumatischen Erkrankungen sind so viele, dass einzelne Krankheitsbilder nicht die kritische Masse bilden, um Aufmerksamkeit zu erregen, es gibt zu wenig Rheumatologen an den Unis und so weiter. Das ist aus meiner Sicht nicht gerechtfertigt, denn es ist ja sensationell, was sich in unserem Fach getan hat.
esanum: 90 Jahre Deutsche Gesellschaft für Rheumatologie, was hat sich in dieser langen Geschichte Grundsätzliches getan?
Lorenz: Ich möchte drei Dinge herausheben. Das erste ist die Entdeckung und Einführung des Kortisons, das in den 1940er Jahren zum ersten Mal eingesetzt wurde. Das war eine Sensation, weil man die entzündlichen Gelenkerkrankungen zumindest phasenweise in den Griff bekam. Es gibt es ein schönes Bild von Raoul Dufy, der hat dankbar die Blüte "La Cortison" gemalt und ist dann leider – wahrscheinlich durch das Kortison mitbedingt - an einem Magendurchbruch verstorben. Die zweite wichtige Entwicklung sind die diagnostischen Möglichkeiten, die wir Ende der 1970er Jahre in die Hand bekamen, um diese Krankheiten erkennen und kategorisieren zu können, sowie Risiken benennen zu können: das waren diagnostische Werkzeuge wie Auto-Antikörper und der Rheumafaktor, die sich über die Jahre bis in die Klinik etabliert haben. Und die dritte große Entwicklung sind spezifische Therapien: Die Einführung des mittlerweile meistverschriebenen Immunsuppressivums Methotrexat und dann Ende der 1980er Jahre die Entwicklung der Biologika.
esanum: Gab es für Sie eine besondere Sternstunde bei einem der Durchbrüche?
Lorenz: Ich war bei der ersten Infusion von Biologika in Deutschland dabei. Das Infliximab wurde 1993 in Erlangen einer Würzburger Pianistin infundiert. Sie hatte eine rheumatoide Arthritis, am nächsten Tag hat sie sich ans Klavier gesetzt und konnte endlich wieder spielen. Das war auch für uns eine Sensation. Dann ging es richtig los, es wurden eine ganze Reihe von Biologika entwickelt und in den Markt eingeführt. Ganz neu zugelassen sind jetzt die Signaltransduktions-Inhibitoren. Das sind chemische Moleküle, die bestimmte intrazelluläre Enzyme, die Januskinasen blockieren, Enzyme, die in den Immunzellen besonders wichtig sind für die proinflammatorische Signaltransduktion von der Zerllmembran in den Zellkern. Vor sechs Wochen wurden die neuen Wirkstoffe Tofacitinib und Baricitinib zugelassen.
esanum: Laufen diese Pharmazeutika dem althergebrachten Methotrexat und anderen jetzt den Rang ab?
Lorenz: Nein, die meisten sind zugelassen in Kombination mit Methotrexat. Kortison fehlt am Anfang meist auch nicht. Dann braucht man noch Schmerztherapeutika. Für die Biologika gibt es verschiedene Zulassungen, solche, die erst nach Methotrexat zugelassen sind, andere die nur in Kombination damit zugelassen sind, solche, die erst nach dem ersten Biologikum zugelassen sind - Rituximab zum Beispiel. In der Klink würde man die neuen Medikamente erst mit Methotrexat oder einem anderen Basistherapeutikum verschreiben, das Methotrexat hat der Patient ohnehin noch im Plan, das läuft dann einfach weiter, wenn es vertragen wird.
esanum: Und woher wissen Sie, welcher Patient von welcher Therapie profitiert?
Lorenz: Das wäre dann die vierte große Entwicklung, die wir bräuchten - ein Biomarker, der uns sagt, wer genau welches Medikament braucht. Es wird viel geforscht – aber es gibt da noch kaum Fortschritt.
esanum: Also Trial-and-Error-Prinzip?
Lorenz: Im Prinzip ja: Wir fangen in der Regel mit Methotrexat und Kortison an. Und wenn es vertragen wird und wir alle Ziele erreicht haben, bleiben wir dabei. Das Ziel ist: Der Patient muss sich wohl fühlen, wir dürfen keine Entzündung mehr finden und maximal 5 mg Kortison einsetzen. Wenn wir das nicht erreicht haben, steigern wir die Dosis oder geben etwas anderes dazu oder wir gehen auf die Biologika. Das müssen wir immer auch mit dem Patienten zusammen entscheiden. Der eine zieht eine Spritze einmal in der Woche vor, der andere reist viel, will lieber Tabletten.
esanum: Stichwort interdisziplinäre Rheumatologie - wie ist die Rolle des Rheumatologen als "Dirigent" in den interdisziplinären Netzwerken zu verstehen?
Lorenz: Der Rheumatologe als klinischer Immunologe muss nicht nur die entzündeten Gelenke oder anderes beachten, sondern eher systemisch denken und agieren, den ganzen Körper betreffend herangehen. Das liegt an den Krankheiten, denken wir an Kollagenosen, Vaskulitiden, die Symptome an den Muskeln, an der Haut, am Haar, am Auge, am Herz verursachen. Die Entzündung kann sich ja überall niederschlagen, deswegen müssen wir auf alle Organe aufpassen. Auch jede vermeintlich gelenkbezogene Entzündung, die Arthritis, ist nur die Spitze des Eisberges, die Entzündung ist immer systemisch, d.h. sie betrifft den ganzen Körper, die Patienten erleiden mehr Herzinfarkte, Schlaganfälle, bösartige Lymphknotentumore, falls wir die Entzündung nicht kontrollieren. Das ist das, was uns zu Systemmedizinern macht. Deswegen müssen wir den Patienten gut aufklären: Nicht rauchen, Cholesterin senken, Diabetes einstellen, Gewicht verlieren, sportlich aktiv sein, möglichst wenig nicht-steroidale Antiphlogistike wie Diclofenac oder Ibuprofen einnehmen. Erst wenn wir das alles erreicht haben, ist der Patient gut eingestellt. Und da braucht es organübergreifendes, internistisches Spezialwissen, das wir von Grund auf lernen.
esanum: Sie müssen also mit jeder anderen Fachrichtung zusammen arbeiten.
Lorenz: So ist es. Das machen wir in Heidelberg z.B. in unserem interdisziplinären Entzüngungsboard, wo Gastroenterologen und Dermatologen mit uns zusammen Fälle besprechen: es gibt immer Patienten, die an Haut, Gelenken, Darm gleichzeitig Symptome haben. Die gemeinsame Besprechung mündet dann in die Festlegung der Therapie durch alle Fachkollegen im interdisziplinären Konsens.
esanum: Welche Vorteile hat das alles für den Patienten?
Lorenz: Die Lebenserwartung ist heute normal, wie bei einem Gesunden. Früher war die Hälfte aller Patienten mit einer rheumatoiden Arthritis nach fünf Jahren erwerbsunfähig. Das passiert heute praktisch nicht mehr.
esanum: Welche Rolle spielt die Einführung der ambulanten spezialärztlichen Versorgungszentren (ASV) für entzündlich-rheumatische Erkrankungen?
Lorenz: Bis jetzt gab es eine Mauer zwischen ambulanter und stationärer Versorgung. Der Versorgungsauftrag der KV war die ambulante Versorgung, die Krankenhäuser waren rein für die stationäre Versorgung zuständig. Die Krankenhausambulanzen dienten als Portal der Versorgung des Patienten vor der stationären Aufnahme. Nun gibt es die DRGs, die langfristig die Bettenzahl verringern sollen. Das schafft aber das Problem in Fächern wie der Rheumatologie, dass man die Patienten weder stationär noch ambulant versorgt bekommt. Es gibt weder genug Betten noch genug ambulant tätige Kollegen. Das hat die Politik zum Glück erkannt und mit der ASV eine neue Abrechnungsmöglichkeit für Krankenhausambulanzen in der Rheumatologie geschaffen.
esanum: Viele Uni-Kliniken haben gar keine Rheumatologie mehr.
Lorenz: So ist das leider - 21 der 36 Universitätsklinika haben keinen internistischen Rheumatologen. Da drängt sich die Frage auf, wer die Studenten Rheumatologie lehrt? Damit fehlt der Nachwuchs aus diesen Klinika, an diesen Klinika fehlen Lehr- und Forschungsstellen, damit wird weniger Forschungsgeld in der Rheumatologie eingeworben und der Teufelskreis schließt sich.
esanum: Und die Versorgungszentren sollen demnächst alle Probleme beheben?
Lorenz: Es ist ein erster Schritt. Es gibt noch einige bürokratische Hürden, ehe man anfangen kann. Ich hoffe, dass es spätestens im nächsten Sommer losgehen kann. Ob das die Versorgungslage gleich revolutionär verändert, wage ich zu bezweifeln. Die Studentenprogramme der DGRh, die darauf zielen Nachwuchs für unser Fach zu begeistern, sind sehr erfolgreich. Wir haben nun viel mehr Bewerbungen als wir Stellen anbieten können. Wenn es aber gelingt, an mehr Kliniken eine zumindest ambulante Rheumatologie einzurichten, dann wird auch das besser.
esanum: Man sagt, mindestens 1300 internistische Rheumatologen wären erforderlich?
Lorenz: Ja, das ist solide errechnet worden. 1300 ist das Minimum. Derzeit sind wir bei 600 bis 700 Rheumatologen.